Zur
Geschichte des
Sudetenlandes
Sudetenland
– kaum ein Atlas
vermag uns heute über
dieses Land, über seine
Lage und Ausdehnung und
seine Sprachgrenzen
genauen Aufschluss zu
geben. Aus Straßenkarten
und Reiseführern
verschwinden die
deutschen Namen seiner
Städte, verschwinden
die deutschen
Landschaftsbezeichnungen,
die Namen von Bergen und
Flüssen, von Burgen und
Schlössern.
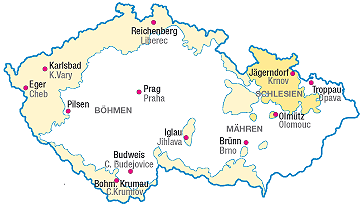
Die
Lage des Sudetenlandes
ist gelb und creme
markiert
Stolze,
klangvolle Namen sind
es, die in ihrer
deutschen Schreibweise
in Geschichte,
Kulturgeschichte und in
die Weltliteratur
eingegangen sind. Wo
wird man einst das
Heinzendorf, den
Geburtsort Gregor
Mendels zu suchen haben?
Wo das Oberplan Adalbert
Stifters, wo die
Goethestätten Karlsbad,
Teplitz und Elbogen, wo
das Marienbad seiner »Marienbader
Elegie«? Wo das
Freiberg von Sigmund
Freud, den
Begründer der
Psychoanalyse. Und wo
das Iglau, das dem
ganzen südosteuropäischen
Raum sein Bergrecht
gegeben hat? Und wo die
Städte einst blühender
Industrien, deren
deutsche Namen in der
Welt für Güte und
Qualität bürgten?
Denken wir nur an
Warnsdorf mit seinen
Strumpfwirkereien, an
die Gablonzer
Schmuckwarenindustrie,
an das »Böhmische Glas«
aus dem nordböhmischen
Glasland um Haida und
Steinschönau, an
Reichenberger Tuche, an
die Graslitzer
Blasinstrumente, an die
Schönbacher Geigen.
Wird man hinter einem
Cheb das Eger Kaiser
Barbarossas vermuten,
das Eger, in dem sich
auf tragische Weise das
Schicksal des großen
Friedländers erfüllte,
jenes Eger, das
Deutschland in Balthasar
Neumann seinen größten
Barockbaumeister
schenkte? Oder wer
vermutet etwa hinter
einem Láznĕ
Jesenik das Gräfenberg
des großen »Wasserdoktors«
Vinzenz Prießnitz? Oder
sind es nicht gerade
diese klangvollen Namen,
die eine Gewähr dafür
geben, dass die
Geschichte dieses Land
als ein deutsches Land
in der Erinnerung
bewahrt? Die Geschichte
wird auch hier das
letzte Wort sprechen.
Als Sudetenland
bezeichnet man das
geschlossene
Siedlungsgebiet der
Deutschen in Böhmen, Mähren
und dem ehemaligen Österreichisch-Schlesien.
Es erstreckt sich in
unterschiedlicher Breite
entlang der
Landesgrenzen gegen (Preußisch-)Schlesien,
Sachsen, Bayern und Österreich
und umfasste 3338
Gemeinden. Außerdem gab
es noch 59 deutsche
Sprachinselgemeinden und
weitere deutsche
Minderheiten im
tschechischen
Sprachgebiet. Dieses
Siedlungsgebiet
entspricht etwa einem
Drittel der Gesamtfläche
von Böhmen und Mähren-Schlesien.
Entsprechend groß war
der deutsche Anteil an
der Gesamtbevölkerung.
Die Zahl der
Sudetendeutschen betrug
rund 3,5 Millionen.
Das
Sudetenland wurde nach
dem Ersten Weltkrieg
gegen den Willen seiner
deutschen Bevölkerung
dem aus der
zerschlagenen
Donaumonarchie neu
geschaffenen Vielvölkerstaat
der Tschechoslowakei
zugeschlagen. Das von
dem amerikanischen Präsidenten
Wilson 1918 verkündete
Selbstbestimmungsrecht
der Völker wurde den
Sudetendeutschen
versagt. In der
Folgezeit wurde ihre
Existenz durch eine
systematische
tschechische
Nationalstaatspolitik
hart bedrängt. Durch
das Münchener Abkommen
von 1938 wurden die Sudetendeutschen Gebiete
in das Deutsche Reich
eingegliedert. England
und Frankreich hätten
an dieser Lösung
bestimmt nicht
mitgewirkt, hätte sie
nicht dem
Selbstbestimmungsrecht
entsprochen.
Nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges
wurden rund 3 Millionen
Sudetendeutsche von der
damaligen
tschechoslowakischen
Regierung unter
unmenschlichen
Bedingungen aus ihrer
angestammten Heimat
vertrieben. Rund 240.000
kamen dabei ums Leben.
Der größte Teil der
vertriebenen
Sudetendeutschen (rd. 2
Mill.) wurde in Süd-
und Westdeutschland
aufgenommen. Weitere 800
000 kamen in die
Sowjetzone, andere nach
Österreich und in viele
andere Länder in Europa
und Obersee. Nur ein
kleiner Teil, schätzungsweise
150.000 bis 180.000,
lebt noch – anfangs
unter misslichen Verhältnissen
– in der alten Heimat.
Lassen
Sie uns eine Wanderung
durch die Sudetendeutschen
Landschaften vornehmen
und beginnen wir im
Böhmerwald,
der sich in über 100
Kilometer Länge vom südlichen
Zipfel Böhmens entlang
der Landesgrenze in
nordwestlicher Richtung
erstreckt. Zu seinen höchsten
Erhebungen auf böhmischer
Seite zählen Lusen
(1370 m), Kubany (1362
m) und Mittagsberg (1314
m). Schier endlos
breiten sich die Wälderwogen
und geben oft nur
kleinen,
weltabgeschiedenen
Ortschaften, Weilern und
Einschichten Raum. Wie
malerisch nimmt sich
etwa das kleine Wallern
mit seinen in alpenländischer
Holzbauweise errichteten
Häusern aus. Eine Reihe
einsamer, dunkler
Waldseen spiegeln Wälder
und Berge und Felsstürze.
Ein lebendiges Stück
Mittelalter bewahren Türme,
Mauern und Tore der Städte
Krummau und Prachatitz.
Der eigentliche Reichtum
des Böhmerwaldes ist
sein Holz. In endlosen
Flößen nahm es seinen
Weg die Moldau hinab zur
Elbe; Schindel- und
Holzschuhmachern gab es
Arbeit und Brot; in
rauchenden Meilern wurde
es zu Holzkohle
verarbeitet.
Wir verfolgen unseren
Weg weiter nach Norden,
wo sich der Böhmerwald,
getrennt durch die Senke
Taus-Furt, im flacheren
Oberpfälzer Wald
(Schwarzkoppe 1039)
fortsetzt. Hier – bei
Taus – schiebt sich
der slawische
Siedlungsraum wie ein
Keil in das deutsche
Sprachgebiet hinein,
fast bis an die
Landesgrenze; dann aber
greift das Deutschtum in
geschlossenem
Siedlungsraum wieder
breit aus, das Tepler
Hochland, den
Kaiserwald, das Duppauer
Gebirge, das
Eger-Falkenauer Becken
und die fruchtbare
Saazer Ebene umfassend,
im Norden begrenzt durch
das steil aufsteigende
Erzgebirge: das Egerland
im weiteren Sinne.
Nun müsste man viel erzählen:
von der Stadt, die
dieser Landschaft den
Namen gab, der alten
freien Reichsstadt Eger
(schon 1061 urkundlich
als »Egire« bezeugt)
mit seiner trutzigen
Kaiserpfalz; von den
Weltbädern Karlsbad,
Marienbad und
Franzensbad; und von den
Dörfern mit ihren, den
Reichtum dieses
Bauernlandes bezeugenden
prächtigen fränkischen,
reich mit Fachwerk
gezierten Vierkanthöfen,
in denen sich viel altes
Brauchtum und die
farbenfrohen Trachten
der Egerländer bis in
unsere Tage erhalten
haben; schließlich vom
Reichtum des Landes: der
Kohle und der
Porzellanerde. Aber es
kann immer nur
angedeutet werden.
In
nordöstlicher Richtung
erstreckt sich, etwa dem
Lauf der Eger folgend,
das Erzgebirge
(Keilberg 1244 m) mit
seinen alten Bergstädten
St. Joachimsthal (das
den ersten Taler prägte
und dem es, ursprünglich
Joachimsthaler Silbermünze,
seinen Namen gab – und
in der Folge sogar dem
Dollar!), Graupen,
Platten und Gottesgab.
Namen wie Zinnwald,
Kupferberg, Bleistadt
sprechen für sich. In
Joachimsthal werden
heute reiche Urangruben
ausgebeutet. Als der
Erzsegen des Gebirges
versiegte, kehrte die
Not in den einst reichen
Städten und Dörfern
ein. Sie war die Mutter
einer ausgedehnten, noch
heute in aller Welt
geschätzten
Heimindustrie
(Spielzeug, Klöppelspitzen).
Zu Füßen des
Osterzgebirges breitet
sich das Brüx-Duxer
Braunkohlengebiet,
begrenzen unseren Blick
die anmutigen Kegelberge
des Böhmischen
Mittelgebirges (Mileschauer
835 m). Wir verweilen in
der alten
Deutschordensstadt
Komotau, in der noch
Schloss und Kirche an
die einstigen Herren
erinnern; wir werfen
einen Blick auf
Teplitz-Schönau, ein
Weltbad wie Karlsbad,
nicht weniger bekannt,
nicht weniger besucht
von den Großen der
Welt; und in Brüx erzählt
uns der alte
Stadtschreiber Leonis
(1493) das Heldenlied
der Brüder Ramphold und
Titus Gorenz während
des Hussitensturmes auf
die Stadt.
Nun haben wir die Elbe
vor uns liegen. In
vielen Schleifen windet
sie sich durch
fruchtbare Hänge, das
»Böhmische Paradies«
genannt, vorbei an der
alten Bischofsstadt
Leitmeritz, dann
hineintauchend in die
Weinhügel, auf denen
schon seit dem 14.
Jahrhundert Reben
gezogen werden. Im Frühling
ertrinkt hier der Blick
im Blütenmeer tausender
Obstbäume.
Nach vielen Kehren haben
wir die Burg
Schreckenstein vor uns
liegen, die Ludwig
Richter in seiner Ȇberfahrt
am Schreckenstein«
festgehalten hat. Gegenüber
der Burg breitet sich
entlang der Elbe und in
die Seitentäler hinein
einer der industriellen
Schwerpunkte Nordböhmens,
Aussig, mit seiner
chemischen Industrie und
dem größten Elbehafen
nach Hamburg.
Bei Tetschen-Bodenbach
nehmen die steil an das
Ufer herantretenden
zerfurchten und
verwitterten
Sandsteinfelsen den
Strom auf und führen
ihn in großen Windungen
durch eines der
reizvollsten Flusstäler
Europas.
Wenden wir uns von hier
nach
Osten,
so haben wir wieder ein
breites deutsches
Siedlungsgebiet vor uns
liegen, das sich erst
hinter Reichenberg, bei
Rochlitz an der Iser,
verengt, um sich gleich
darauf an den Südhängen
des Riesengebirges
wieder breit
auszudehnen: jene
Industrielandschaft, die
den Weltruf der Sudetendeutschen
Wirtschaft begründete.
Das nordböhmische
Niederland überzog eine
reiche Textilindustrie
mit Webereien,
Spinnereien und
weltbekannten
Strumpfwirkereien (Warnsdorf,
Schönlinde); Gablonz
war das Zentrum der
Schmuckwarenindustrie;
in und um Haida und
Steinschönau
konzentrierten sich die
Betriebe der
Hohlglasveredlung und
der Lüstererzeugung ;
Reichenberg war berühmt
für seine Tuche. Am Südhang
des Riesengebirges und
in dessen Vorland lagen
die Hauptplätze der
Leinen- und
Papierindustrie (Hohenelbe,
Arnau, Trautenau). Die
Kargheit des Bodens hat
diesen zähen,
unternehmerischen nordböhmischen
Menschenschlag geformt.
Das Land ist mit vielfältigen
landschaftlichen Schönheiten
gesegnet, im Norden
begrenzt durch
Lausitzer,
Iser- und Riesengebirge
(Schneekoppe 1603 m).
Südlich des Lausitzer
Gebirges, inmitten
fruchtbaren Agrarlandes,
breitet sich die nordböhmische
Seenplatte, weithin überragt
vom Doppelhaupt der Bösige;
ein Wanderparadies von
großer Anmut und
Lieblichkeit ist die
Daubaer Schweiz.
Östlich an das
Riesengebirge schließt
sich das Braunauer Ländchen
an mit dem weitberühmten
Felsenlabyrinth von
Adersbach und Wekelsdorf.
Der
Zug der Sudeten setzt
sich in
Adler-
und Altvatergebirge (Altvater
1492 m), in Gesenke und
Odergebirge fort.
Industrie (Textil) und
Gewerbefleiß waren die
Grundlagen der kleinen
schlesischen und nordmährischen
Städte Jägerndorf, Würbenthal,
Freiwaldau und
Freudenthal, Mährisch-Schönberg,
Sternberg und Römerstadt.
Vergessen wir auch nicht
die Luft- und
Wasserheilkurorte Gräfenberg
(mit Prießnitz-Sanatorium)
und Nieder-Lindewiese
(Schrothkuren).
Mittelpunkt dieser
Landschaft und bis 1918
Landeshauptstadt von Österreichisch-Schlesien
war Troppau, eine
aufgeschlossene
Weltstadt mit festem
Theater und stattlichen
Baudenkmälern, wie der
Propsteipfarrkirche und
dem »Schmetterhaus«,
einst Zentrum des
schlesischen
Tuchhandels.
Südlich
davon zwischen Adler und
Oberlauf der March,
durch einen slawischen
Sprachkeil abgetrennt,
teils noch nach Böhmen
hinübergreifend, stoßen
wir im
Schönhengstgau
auf fruchtbares
Bauernland, auf dem sich
uralte Vätersitte und
Brauchtum bis in unsere
Zeit erhalten konnten.
Der Schönhengstgau
beheimatete auch eine
reiche Leinen- und
Seidenindustrie.
Zwischen den Ausläufern
der Sudeten und den
Beskiden liegt das
anmutige Kuhländchen,
das seinen Namen einer
mustergültigen und
weitberühmten
Rinderzucht verdankt.
Neben der Landwirtschaft
stoßen wir in den
kleinen Städten wieder
vornehmlich auf
Textilindustrie, in
Neutitschein auf die in
ganz Europa bekannten
Hutfabriken.
Werden
die im Westen und Norden
gelegenen deutschen
Gebiete Böhmen-Mähren-Schlesiens
nach außen hin .von
Gebirgen begrenzt, so
liegt das Land im Süden
gegen Österreich hin
offen. Weite, fruchtbare
Ebenen bestimmen den
Charakter
Südmährens
als ausgesprochenes
Agrarland, in dem ein
ausgedehnter Obst- und
Gemüsebau heimisch war
(Znaimer Gurken); an den
sanften Hängen reifte
ein geschätzter Wein.
Das vielgewundene
Thayatal mit seinen
schroffen Ufern und die
aus der Ebene
aufragenden Pollauer
Berge setzen dem Land
manche reizvolle Tupfer
auf. Mittelpunkt war
Znaim mit seiner einprägsamen
mittelalterlichen
Stadtsilhouette,
ausgestattet mit dem ältesten
Stadtrecht in Mähren
(1226), aber schon zwei
Jahrhunderte vorher
urkundlich genannt.
Handelte
es sich bei den bisher
geschilderten Sudetendeutschen
Landschaften um
geschlossenes deutsches
Siedlungs- und
Sprachgebiet, so stoßen
wir daneben
allenthalben, vor allem
in Mähren, auf Reste
alter deutscher
Siedlungen, die vom
tschechischen
Sprachgebiet umschlossen
sind, auf sogenannte Sprachinseln,
wie z. B. um Budweis,
Iglau (der größten
unter ihnen), Brünn,
Wischau, Olmütz
und Mährisch-Ostrau.
Auf sich selbst
gestellt, ständig bedrängt
vom anderen Volkstum,
bewahrten sie durch
Jahrhunderte ihr
deutsches Gesicht. Für
Volkskundler und
Sprachforscher erwiesen
sie sich als reiche
Fundstätten.
Man kann diese kurze
Betrachtung nicht schließen,
ohne auch
Prag
gedacht zu
haben, das ohne die
Deutschen so nicht
denkbar wäre: als die
hunderttürmige Stadt,
deren Gesicht deutsche
Baumeister und Künstler
in Jahrhunderten
entscheidend mitgeprägt
haben. Der tschechische
Chronist Cosmas
berichtet im
Zusammenhange mit dem
Einzug Dietmars, des
ersten Bischofs von Prag
(973), dass er von der
Bevölkerung mit einem
deutschen »Leis«
(einem geistlichen Lied)
empfangen worden sei.
Damals, und
wahrscheinlich schon früher,
dürfte Prag schon eine
starke deutsche
Gemeinde, Kaufleute und
Handwerker, besessen
haben, die in der Folge
von den Fürsten immer
wieder mit besonderen
Privilegien ausgestattet
wurde (Sobieslaw II.,
12. Jh.: »Wisset, dass
die Deutschen freie
Leute sind!«). Am böhmischen
Königshof erlebte der
deutsche Minnesang eine
schöne Nachblüte,
deutsch war die
Hofsprache, ja, König
Wenzel II. dichtete
selbst deutsche
Minnelieder.
Mit dem Erlöschen des
Przemyslidengeschlechts
fällt die böhmische
Krone an die deutschen
Luxemburger, die in der
zweiten Generation (Karl
IV.) auch die deutsche
Kaiserwürde erlangen.
Damit wird Prag
Mittelpunkt des Heiligen
Römischen Reiches
Deutscher Nation. Karl
IV. ist es, der
Baumeister aus allen Ländern,
vornehmlich aus
Deutschland, nach Prag
ruft, unter ihnen als
den bedeutendsten Peter
Parler. Ihm verdankt
Prag seinen Veitsdom,
ein Kronjuwel deutscher
Gotik, und die steinerne
Karlsbrücke über die
Moldau mit ihren
wehrhaften Brückentürmen;
er baut die Burg
Karlstein über der
Beraun und die
Barbarakirche zu
Kuttenberg. 1348 gründet
Karl IV. in Prag die
erste Universität
Deutschlands und
Mitteleuropas. In der
St.-Niklas-Kirche des
Kilian Ignaz
Dientzenhofer jubelt das
böhmische Barock. Auch
hier mögen diese kurzen
Andeutungen genügen.